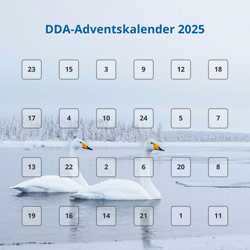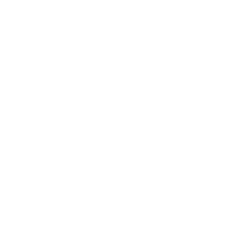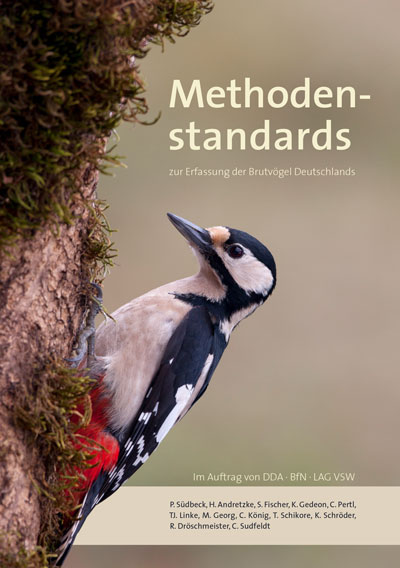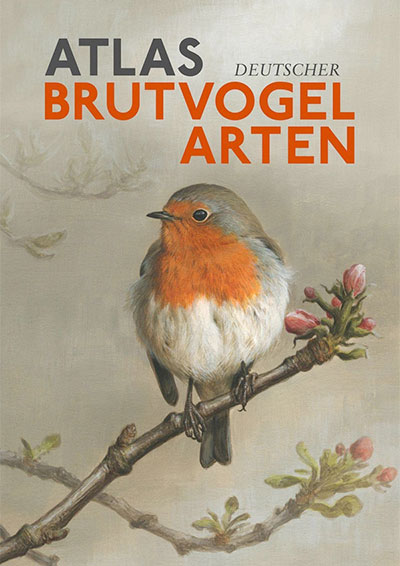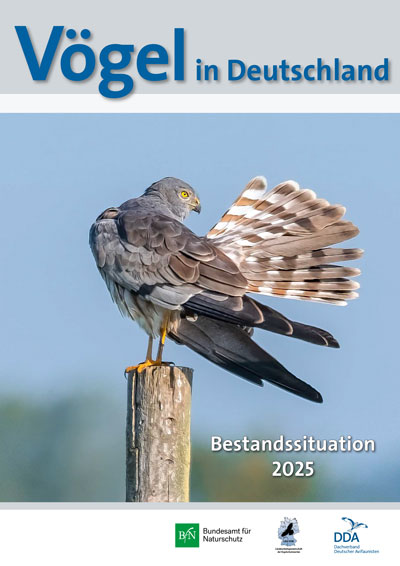Dachverband
Service
Jobs & Praktika
Häufige Brutvögel (MhB)
Seltene Brutvögel (MsB)
Rastende Wasservögel (MrW)
In Schutzgebieten (VM-S)
Seevogelmonitoring
Forschung
ADEBAR 2